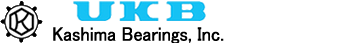Diesmal werfen wir einen genaueren Blick auf verschiedene Kunststoffarten und konzentrieren uns dabei auf ihre Zug-, Druck- und Biegefestigkeit.
Wie wählt man das richtige Kunststoffmaterial für eine bestimmte Anwendung aus?
Da die Materialauswahl stark von den Einsatzbedingungen abhängt, kann sie recht komplex sein. Bei Kashima Bearings berücksichtigen wir eine Vielzahl von Faktoren, wie zum Beispiel:
- Verschleißfestigkeit
- Mechanische Festigkeit
- Wärmebeständigkeit
- Kosten
In diesem Artikel liegt der Fokus speziell auf der „mechanischen Festigkeit“.
Es gibt verschiedene Arten von Festigkeit, die wichtigsten sind jedoch:
- Zugfestigkeit
- Druckfestigkeit
- Biegefestigkeit
Schauen wir uns an, was diese jeweils bedeuten.
● Zugfestigkeit
Die Zugfestigkeit beschreibt die Kraft, die erforderlich ist, um ein Kunststoffmaterial in eine Richtung zu dehnen, bis es sich zu verformen beginnt oder bricht. Beim Wort „dehnen“ denkt man vielleicht an Kaugummi oder Gummi, aber auch Kunststoffe lassen sich bis zu einem gewissen Punkt unter Zugspannung dehnen.
Im Material wirken dabei zwei entgegengesetzte Kräfte: eine, die sich der Dehnung widersetzt, und eine, die sie zulässt. Die widerstehende Kraft nennt man „Spannung“. Wenn das Material seine Belastungsgrenze erreicht, kann es dieser nicht mehr standhalten, beginnt sich zu verformen oder bricht. Diese Grenze wird als Zugfestigkeit definiert.
● Druckfestigkeit
Sie bezeichnet die Kraft, die nötig ist, um ein Material unter Druck zu verformen oder zu zerstören. Die meisten Kunststoffe weisen eine höhere Druck- als Zugfestigkeit auf. Dies ist besonders relevant bei Materialien, die unter Druckbelastung versagen können – zum Beispiel duroplastische Kunststoffe oder verstärkte Verbundwerkstoffe wie Phenol- oder Epoxidharze sowie kohlenstoffbasierte Kunststoffe.
Man kann sich dies wie beim Brechen eines Betonblocks vorstellen: Er verformt sich kaum – er zerbricht einfach unter hoher Last. Dasselbe Prinzip gilt für bestimmte harte Kunststoffe.
Allerdings verformt sich jedes Material vor dem Bruch in gewissem Maße. Bei zähen Materialien wie PTFE (Teflon) oder UHMWPE kann es sein, dass gar kein Bruch im klassischen Sinne eintritt. Stattdessen wird die Druckfestigkeit oft als die Last definiert, bei der eine bleibende Verformung (z. B. 5 %) auftritt.
Daher sollte man die jeweilige Definition des Herstellers beachten – manche verwenden den Streckpunkt oder die Verformungsgrenze, andere den tatsächlichen Bruch.
● Biegefestigkeit
Dies ist die Kraft, die erforderlich ist, um unter Biegebelastung Risse oder Brüche zu verursachen. Bei der Biegefestigkeit wirken Zug- und Druckkräfte gleichzeitig. Sie unterscheidet sich daher von der „Biegespannung“, die die innere Spannungsverteilung beschreibt und komplexer ist. Der Einfachheit halber konzentrieren wir uns hier auf die Biegefestigkeit und verschieben das Thema Spannungsverteilung auf einen späteren Artikel.
Wie diese Definitionen zeigen, beschreibt Festigkeit die Kraft, die erforderlich ist, um ein Material zu verformen oder zu brechen. Die angegebenen Werte sind also keine sicheren Betriebsbelastungen, sondern Bruchgrenzen.
● Vergleich der Festigkeiten gängiger Kunststoffe
| Material | Zugfestigkeit (MPa) | Dehnung (%) | Druckfestigkeit (MPa) | Biegefestigkeit (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| PTFE | 20–34 | 400 | 10–15 (bei 23 °C) | – |
| UHMWPE | 40 | 300 | 20 (5 % Verformung) | 22 |
| PEEK | 98 | 20 | 119 (5 % Verformung) | 170 |
| Phenolharz | 68–108 | – | 127–167 | 137–196 |
| Epoxidharz | 245–343 | – | 147–245 | 294–392 |
Alle Werte in MPa (Megapascal).
● Interpretation der Daten
Epoxid- und Phenolharze erscheinen in den Werten extrem stark. Allerdings dehnen sie sich nicht – sie brechen abrupt. Das bedeutet, sie bieten kaum elastische Rückverformung, können aber hohe Lasten ohne Verformung tragen.
PTFE hat keine angegebene Biegefestigkeit, da es nicht bricht, sondern sich einfach biegt. Die Zugfestigkeit ist relativ gering, aber es kann sich bis zu 400 % dehnen, was bedeutet, dass es sich unter geringer Belastung stark verlängern kann. Dasselbe gilt für UHMWPE. Diese Materialien sind für hohe Dauerlasten weniger geeignet und müssen entsprechend bedacht eingesetzt werden.
PEEK liegt in der Mitte – weniger spröde als Epoxide, aber nicht so flexibel wie PTFE. Kunststoffe wie PPS oder POM gehören ebenfalls zu dieser „mittleren“ Kategorie.
● Hinweise aus der Praxis
Bei Kashima Bearings sind wir auf Gleitkomponenten wie Lager und Zahnräder spezialisiert. Dabei berücksichtigen wir nicht nur die Festigkeit, sondern auch Verschleißfestigkeit und Wärmebeständigkeit.
In einem Fall nutzte ein Kunde UHMWPE in einer Hochlastanwendung. Die Maschine zeigte Probleme, und wir wurden hinzugezogen. Zunächst ging der Anwender nicht davon aus, dass das Bauteil das Problem sei, aber bei der Inspektion stellten wir fest, dass es sich unter Druck und Hitze stark verformt hatte. Diese Verformung führte zu einer Fehlstellung der Welle und schließlich zum Funktionsausfall – auch wenn kein Bruch vorlag.
Wir lösten das Problem durch die Auswahl eines anderen Materials. Materialänderungen beeinflussen jedoch mehr als nur die Festigkeit – auch Verschleißverhalten, Temperaturbeständigkeit und weitere Eigenschaften ändern sich. Eine ganzheitliche Bewertung ist daher immer notwendig.
Im Gegensatz zu Metallen, bei denen Härte und Festigkeit oft Hand in Hand gehen, sind Kunststoffe viskoelastisch – sie verformen sich leichter und verhalten sich unter Last anders. Während Epoxide und Phenolharze höhere Festigkeitswerte als PTFE oder UHMWPE aufweisen, halten letztere in vielen Lageranwendungen oft länger, da sie verschleißfester und elastischer sind.
Fazit: Zahlen allein erzählen nicht die ganze Geschichte. Bei der Auswahl von Kunststoffen sollte stets der gesamte Einsatzkontext berücksichtigt werden.